fortsetzung
Subtext/argumente: 2.25.00 bis
2.25.18
2.25.00
die wiederholung des gedankens:
2.62.08/(c/06), in einer graphik.
Die momente:
individuum als ich
innen(=anerkennung)
aussen(=vertrag)
Die relationen:
1.rel.: individuum_als_ich<==|==>innen(=anerkennung)
2.rel.: individuum_als_ich<==|==>aussen(=vertrag)
3.rel.: innen(=anerkennung)<==|==>aussen(=vertrag)
graphik: 100
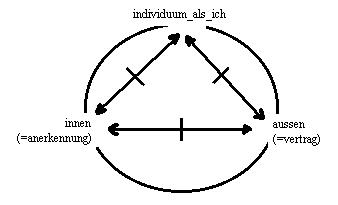
(2.62.08/(c/06))<==//
2.25.01
die wiederholung des gedankens:
2.63.23/(c/01/*3), in einer graphik(a). Die momente sind:
1.moment: das individuum
als ich
2.moment: der himmel, der frieden,
die fülle(b)
3.moment: die hölle, der krieg,
der mangel.
Die relationen:
1.rel.: individuum_als_ich<==|==>himmel(frieden,fülle)
2.rel.: individuum_als_ich<==|==>hölle(krieg,mangel)
3.rel.: himmel(frieden,fülle)<==|==>hölle(krieg,mangel)(c).
graphik: 101
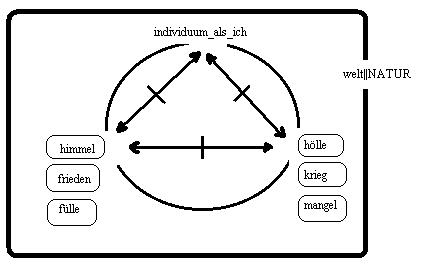
---
(a)
in die graphik einbezogen
ist der fall in der anmerkung: (d).
(b)
die fülle im sinn von
überfluss; alles ist verfügbar und an nichts mangelt es.
(c)
das zeichen: welt||NATUR
zur klarstellung eingefügt.
(2.63.23/(c/01/*3))<==//
2.25.02
die wiederholung des gedankens:
2.63.13/(f), in einer graphik(a).
Das vermittelnde moment ist das individuum als ich in der funktion des
ausgeschlossenen dritten moments(b).
Die momente:
1.moment: das individuum
als ich
2.moment: die reale gewalt(=phänomen)
3.moment: die sprache(=wort).
Die relationen:
1.rel.: individuum_als_ich<==|==>reale
gewalt(=phänomen)
2.rel.: individuum_als_ich<==|==>sprache(=wort)
3.rel.: reale gewalt(=phänomen)<==|==>sprache(=wort).
graphik: 102a
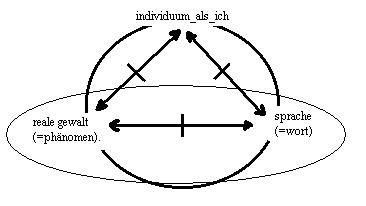
----
(a)
in seiner struktur ist die
graphik vergleichbar mit dem argument: 2.63.05/(f).
Die termini in den momenten: 2 und 3, sind entsprechend angepasst.
...
1.moment: das individuum als ich
2.moment: (gewalt(=real) //(=die
reale gewalt(=phänomen))
3.moment: (gewalt(=ästhetisch_reflektiert)
//(=sprache(=wort)).
graphik: 102b
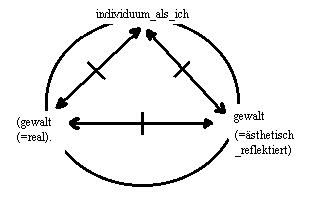 (a)<==//
(a)<==//
(b)
die problematische 3.relation
ist mit einer elipse in dünnem strich markiert.
(b)<==//
(2.63.13/(f))<==//
2.25.03
die wiederholung des gedankens:
2.53.37/(f), in einer graphik. Die korruption ist eine ménage à
trois, die durch einen deal affiziert ist. Die beteiligten: "der amtswalter:_A,
der bürger:_B und der unbeteiligte_dritte:_C" sind durch wechselseitige
relationen miteinander relationiert(a).
Die relationen:
1.rel.: amtswalter:_A<==>bürger:_B
2.rel.: amtswalter:_A<==>unbeteiligte_dritte:_C
3.rel.: bürger:_B<==>unbeteiligte_dritte:_C.
graphik: 103a
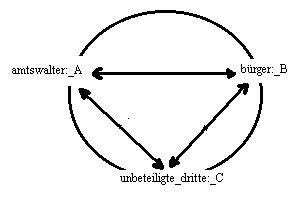
In dieser ménage à
trois ist der deal eine sache, die prima vista nur die relation zwischen
A und B betrifft, die wechselseitige relation in zwei abhängige relationen
transformierend:
1.rel.: A<==|==>(deal)
2.rel.: (deal)<==|==>B.
Die relation A<==>B, ist äquivalent
mit der situation: A<==|==>(deal)<==|==>B.
graphik: 103b
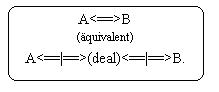
Dasselbe dargestellt im schema des
trialektischen modus.
Die relationen:
1.rel.: A<==>B
2.rel.: A<==|==>(deal)
3.rel.: (deal)<==|==>B.
graphik: 103c
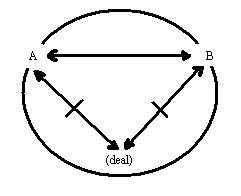
In der ménage à trois
affiziert der deal zwischen A und B immer den unbeteiligten dritten: C,
dargestellt im schema des trialektischen modus.
Die relationen:
1.rel.: A<==|==>(deal)<==|==>B
2.rel.: A<==>C
3.rel.: B<==>C.
graphik: 103d
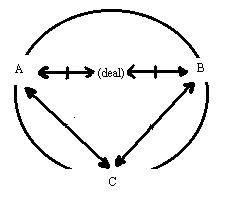
Dieser gedanke, den deal in das zentrum
stellend, zeigt secunda vista eine komplexe struktur, in der 2 schemata
im trialektischen modus, die graphiken: 103a und 103c, übereinandergeschichtet
sind.
graphik: 103e
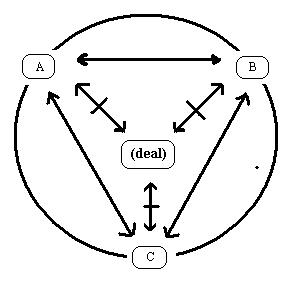
Zusatz. Der deal zwischen A und B
hat eine gedoppelte vermittlungsfunktion, in der allein die machtverhältnisse
zwischen allen, die es betrifft, gespiegelt sein können. Zum ersten
erscheint die reale machtverteilung zwischen A und B in der maske der herrschaft,
zum zweiten die macht, präziser das ausmaass der ohnmacht des unbeteiligten
dritten: C, zu A und B. Die differenzen in der verfügbarkeit der machtmittel
bewirken das verhalten aller beteiligten, vor allem dann, wenn der fall
als skandal publik geworden ist.
----
(a)
aus pragmatischen gründen
ohne weitere erklärungen in den graphiken auf die buchstaben: "A,
B und C" reduziert. (a)<==//
(2.53.37/(f))<==//
2.25.04
die wiederholung des gedankens:
2.53.18/(b), in einer graphik.
In seiner grundform ist das schema
im trialektischen modus überschaubar.
Die momente: "individuum als ich:
A, der genosse: B, und die relation: macht<==|==>gewalt,"(a).
Die relationen:
1.rel.: A<==>B
2.rel.: A<==|==>(relation:_macht<==|==>gewalt)
3.rel.: B<==|==>(relation:_macht<==|==>gewalt)
graphik: 104a
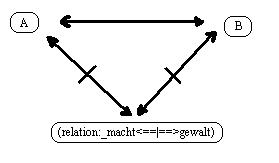
In der analyse sind zwei varianten
der interpretation möglich(b).
Variante 1:
Das individuum als ich:
A, und sein genosse: B, jeder für sich, machen die relation: macht<==|==>gewalt,
zum gegenstand ihrer analyse und zerlegen die relation in ihre teile. Das
ergebnis sind zwei schemata, die nicht identisch fallen können. Sie
werden in der graphik nebeneinander gestellt, die grundform als 3.schema
dazwischen, abgetrennt durch einen dünnen strich.
Die relationen sind: )
1.rel.: (A_oder_B)<==|==>macht
2.rel.: (A_oder_B)<==|==>gewalt
3.rel.: macht(A_oder_B)<==|==>gewalt(A_oder_B).
graphik: 104b
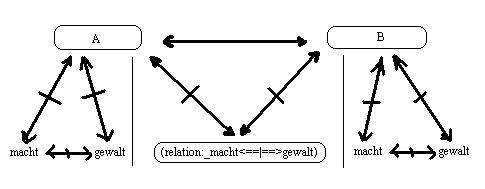
Variante 2:
Das problem ist die relation:
macht<==|==>gewalt,(c)
die das individuum als ich: A, und sein genosse: B, im horizont ihres begriffs
von welt interpretieren. Die momente in den schemata sind: "das individuum
als ich: A, oder sein genosse: B, die relation: macht<==|==>gewalt,
jeweils in der interpretation des A oder des B, und es ist der begriff:
welt, den beide, jeder für sich, denken. Das ergebnis sind zwei schemata,
die nicht identisch fallen können. Sie werden in der graphik nebeneinander
gestellt, die grundform als 3.schema dazwischen, abgetrennt durch einen
dünnen strich.
Die relationen:
1.rel.: (A_oder_B)<==|==>begriff:_welt(A_oder_B)
2.rel.: (A_oder_B)<==|==>(rel.:_m<==|==>g)(A_oder_B)
3.rel.: begriff:_welt(A_oder_B)<==|==>(rel.:_m<==|==>g)(A_oder_B).
graphik: 104c
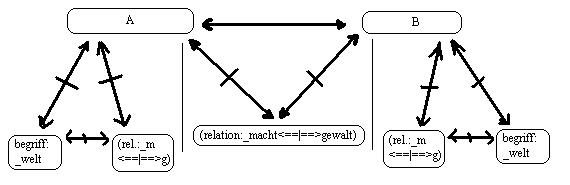
Das resultat der analyse kann akzeptiert
werden oder auch nicht, aber wie dem auch sei, die resultate der analyse
werden dann zu einem problem, das ist die dialektik der macht und der gewalt,
wenn in der synthetisierenden reflexion, sowohl vom individuum als ich
als auch vom genossen gedacht, die 3.relation: begriff:_welt(A_oder_B)<==|==>(rel.:_m<==|==>g)(A_oder_B),
in die grundform eingesetzt wird. In der diskussion stehen dann de facto
drei varianten, deren differenzpunkt der jeweilige begriff: welt, ist,
der aber, weil die relation: macht<==|==>gewalt, für sich als phänomen
mit sich identisch, über kreuz verknüpfbar ist(d).
Die momente: "individuum als ich:
A, der genosse: B, und die relation: macht<==|==>gewalt, oder die relationen:
(rel.:_begriff:_welt(A_oder_B))<==|==>(rel.:_m<==|==>g)(A_oder_B))".
Die relationen:
1.rel.: A<==>B
2.rel.: A<==|==>(rel.:_m<==|==>g)
//oder(rel.:_begriff:_welt(A))<==|==>(rel.:_m<==|==>g)(A)) //oder
(rel.:_begriff:_welt(B))<==|==>(rel.:_m<==|==>g)(B))
3.rel.: B<==|==>(rel.:_m<==|==>g)
//oder(rel.:_begriff:_welt(A))<==|==>(rel.:_m<==|==>g)(A)) //oder
(rel.:_begriff:_welt(B))<==|==>(rel.:_m<==|==>g)(B))
graphik: 104d
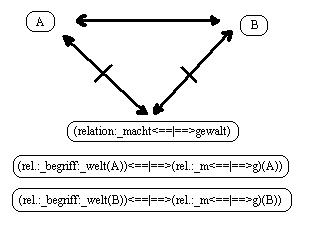
----
(a)
in den graphiken aus pragmatischen
gründen auf die buchstaben: A und B verkürzt. Alle graphiken
ohne das zeichen: kreis, für den begriff: welt.
(a)<==//
(b)
weitere varianten sind denkbar,
aber diese bleiben dem rezipienten des arguments überlassen.
(b)<==//
(c)
die formel: "relation: macht<==|==>gewalt,"
ist aus technischem grund verkürzt auf das zeichen: rel.:_m<==|==>g.
(c)<==//
(d)
die verknüpfungen über
kreuz sind wegen ihrer komplexität in der graphischen darstellung
unübersichtlich und werden deshalb nicht gesondert ausgewiesen.
(d)<==//
(2.53.18/(b))<==//
2.25.05
die wiederholung des gedankens:
2.53.24/(b/02), in einer graphik.
Die ausgangssituation ist überschaubar(a).
Die momente sind: individuum als
ich, ding der welt: n, und dokument der historia: m.
Die relationen:
1.rel.: individuum_als_ich<==|==>ding_der_welt:_n
2.rel.: individuum_als_ich<==|==>dokument_der_historia:_m
3.rel.: ding_der_welt:_n<==|==>dokument_der_historia:_m.
graphik: 105
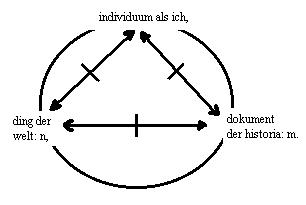
----
(a) die situation erscheint dann
komplex, wenn der genosse in die reflexion einbezogen wird, der in analytischer
absicht ausgeschlossen bleiben soll(01). Es liegen jeweils die gleichen
schemata vor mit der differenz, dass an der stelle des individuums als
ich der genosse erscheint. Diese schemata sind in ihrer struktur gleich,
sie erscheinen als gleich, aber sie können sich bis zum wechselseitigen
ausschluss unterscheiden. Das ding der welt: n, identisch mit sich selbst,
kann erstens als beliebiges weltding interpretiert werden, zweitens als
das bestimmte dokument der historia: m. Die differenz ist nicht im ding
der welt verortet, wohl aber im individuum als ich und seinem genossen,
die es unterscheidend beurteilen, dieses ding der welt als das ding der
welt: n, oder als das dokument der historia: m.
----
(01)
es bleibt dem rezipienten
überlassen, sich selbst die möglichen situationen zu verdeutlichen(*1).
Hilfreich können die graphiken im argument: 2.52.04,
sein.
----
(*1) argument: //==>2.24.01.
(2.53.24/(b/02))<==//
2.25.06
die wiederaufnahme und weiterentwicklung
des gedankens: 2.53.24/(i/02), in einer graphik.
Im fokus steht das individuum als
ich: A, und sein genosse: B, die wechselseitig relationiert sind. Ihr gemeinsamer
bezugspunkt ist die ideologie, die sie gemeinsam teilen können oder
auch nicht(a).
Ihre relation ist durch die momente: macht und herrschaft, bestimmt. Es
ergeben sich 4 schemata, die nicht identisch fallen, aber übereinander
geschichtet in einer graphik zusammengefasst werden können(b).
Das grundschema:
Die momente: ideologie,
herrschaft und macht.
Die relationen:
1.rel.: ideologie<==|==>herrschaft
2.rel.: ideologie<==|==>macht
3.rel.: herrschaft<==|==>macht.
graphik: 106a
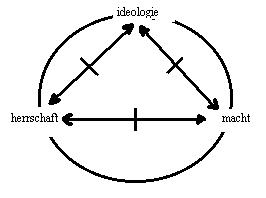
Die schemata: 1-3, mit der relation:
A<==>B, als vermittelndem moment(c).
1.schema:
Die relationen:
1.rel.: (A<==>B)<==|==>ideologie
2.rel.: (A<==>B)<==|==>herrschaft
3.rel.: ideologie<==|==>herrschaft
graphik: 106b
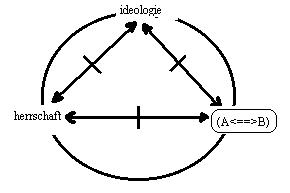
2.schema
1.rel.: (A<==>B)<==|==>ideologie
2.rel.: (A<==>B)<==|==>macht
3.rel.: ideologie<==|==>macht
graphik: 106c
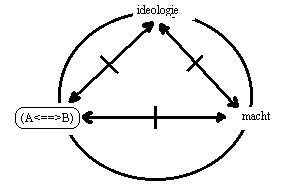
3.schema
1.rel.: (A<==>B)<==|==>herrschaft
2.rel.: (A<==>B)<==|==>macht
3.rel.: herrschaft<==|==>macht
graphik: 106d
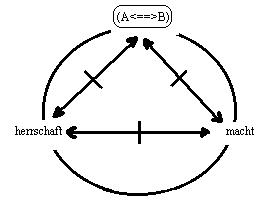
Die verknüpfung der 4 schemata
in einer
graphik: 106e
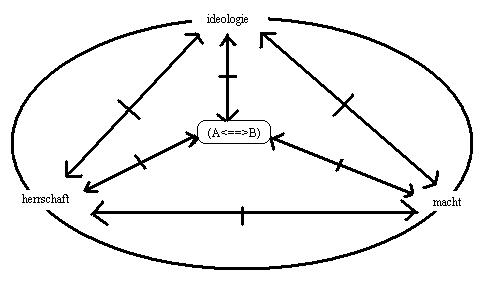
----
(a)
das problem dieses arguments
ist seine komplexität, die in ihrer darstellbarkeit nur begrenzt möglich
ist. Die möglichkeit, dass das individuum als ich und sein genosse
gegensätzlichen ideologien folgen, ist der regelfall; dieser soll
hier in analytischer absicht ausgeklammert bleiben. (a)<==//
(b)
der grundgedanke in den
argumenten: 2.24.38
und 2.24.76, wird aufgenommen
und angepasst weiter entwickelt. (b)<==//
(c)
die relation: (A<==>B),
kann im grundschema in den momenten: "ideologie, herrschaft und macht"
gleichrangig eingesetzt werden. Für die graphiken: 106b-d, ist in
jedem fall die 3.relation das kriterium der reihenfolge und im jeweils
ausgeschlossenen dritten moment ist die relation: (A<==>B), eingesetzt.
Die reihenfolge ist ad libitum. (c)<==//
(2.53.24/(i/02))<==//
2.25.07
die wiederholung des gedankens:
2.53.24(i/03), in einer graphik.
Die momente sind: individuum als
ich: A(=gläubiger), der genosse:_B(=prophet) und die ideologie(=text)(a).
Die relationen:
1.rel.: individuum_als_ich:_A(=gläubiger)<==>genosse:_B(=prophet)
2.rel.: individuum_als_ich:_A<==|==>ideologie(=text)
3.rel.: genosse:_B(=prophet)<==|==>ideologie(=text).
graphik: 107
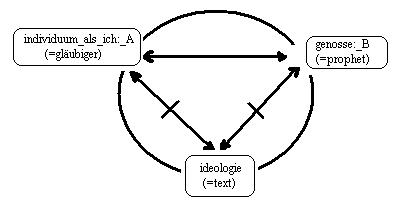
---
(a)
die termini in der klammer
verweisen auf die bestimmte funktion des individuums als ich und seines
genossen; folglich sind es eigenständige schemata, die in ihrer struktur
gleich sind, aber niemals identisch fallen können. Aus pragmatischen
gründen werden sie in einer graphik zusammengezogen. Die analyse ist
auf die grundstruktur reduziert. Alle erweiterungen, die die komplexität
des dargestellten weiter erhöhen, bleiben hier unberücksichtigt.
(2.53.24(i/03))<==//
2.25.08
die wiederholung des gedankens:
2.53.20/(b), in einer graphik.
Im blick auf das symbol: n, macht repräsentierend(a),
kann die relation: individuum_als_ich:_A<==>genosse:_B, erweitert durch
das zeichen: "symbol:_n,(=macht)"(b)
auch in zwei abhängigen relationen: individuum_als_ich:_A<==|==>(symbol:_n,(=macht))
und (symbol:_n,(=macht))<==|==>genosse:_B, äquivalent darstellt werden(c):
graphik: 108a
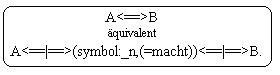
Der gedanke, wiederholt im trialektischen
modus:
Die relationen:
1.rel.: A<==>B
2.rel.: A<==|==>(symbol:_n,(=macht)))
3.rel.: (symbol:_n,(=macht))<==|==>B.
graphik: 108b
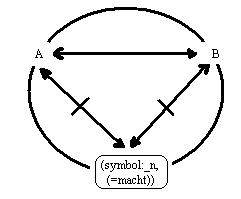
---
(a)
das, was prima vista als
eine einfache konstellation erscheint, das ist, wenn secunda vista die
relation: A<==>B, analysiert wird, eine komplexe situation, die hier
kurz angedeutet sein soll. Das individuum als ich: A, und sein genosse:
B, können das symbol: n, mit dem begriff: macht, gefasst als phänomen,
relationieren. Damit sind zwei schemata gesetzt, die nicht identisch fallen
können, gleichwohl sie im symbol: n, macht repräsentierend, ein
ding der welt zur hand haben, das mit sich identisch sein muss. In der
entfalteten graphik, die graphiken: 108e und 108f, ist erkennbar, dass
einerseits das symbol: n, mit sich identisch sein muss, der begriff: macht,
als phänomen im symbol: n, repräsentiert, aber nicht identisch
sein kann, gleichwohl die begriffe: macht, gleich sein können, die
das individuum als ich: A, und sein genosse: B, denken(01). In dieser differenz
ist die voneinander abweichende einschätzung der macht zwischen beiden
zu verorten, einerseits markiert mit dem dicken senkrechten strich als
trennung, andererseits markiert mit dem gleichheitszeichen: =, als gleichheit
der machtbegriffe und/oder als identität des machtsymbols: n.
Die schemata: 1 und 2.
Die momente:
das individuum als ich:_A,
oder der genosse:_B,
das symbol:_n,
der begriff:_macht".
Die relationen:
1.rel.: individuum_als_ich:_A/oder_genosse:_B<==|==>symbol:_n,(=macht)
2.rel.: individuum_als_ich:_A/oder_genosse:_B<==|==>begriff:_macht
3.rel.: symbol:_n,(=macht)<==|==>begriff:_macht
Das schema: 1,
in der perspektive des A:
symbol:_n,(=macht)<==|==>begriff:_macht(=A),
graphik: 108c
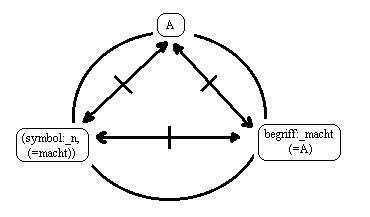
.
Das schema: 2,
in der perspektive des B:
begriff:_macht(=B)<==|==>symbol:_n(=macht),
graphik: 108d
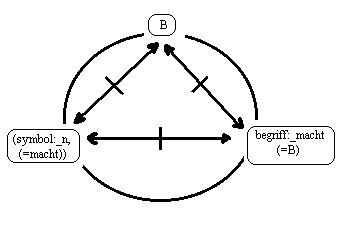
.
Die verknüpfung der schemata: 1
und 2,
erstens
in der perspektive des machtbegriffs:
machtbegriff:_A||machtbegriff:_B:
graphik: 108e
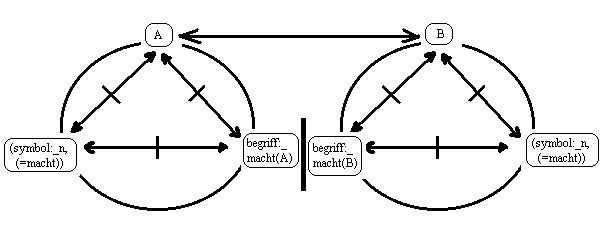
zweitens
in der perspektive des symbols:_n,(=macht):
graphik: 108f
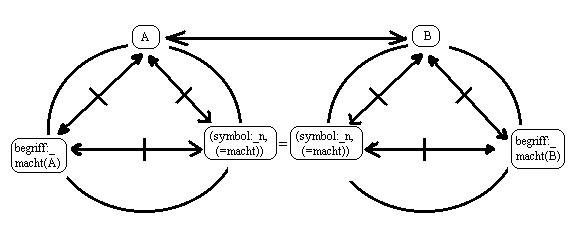
.
----
(01)
eine weitere stufe der komplexität
ist erreicht, wenn der genosse: B, und das individuum als ich: A, den begriff:
macht, des jeweils anderen zum moment ihrer relationen machen. Diese schemata,
niemals identisch fallend, sind in der übereinanderschichtung graphisch
nicht mehr überzeugend darstellbar(*1).
----
(*1) argument: //==>2.24.01.
(a)<==//
(b)
die differenz in der form
des zeichens: symbol: n, und des zeichens: symbol:_n,(=macht), ist stilistisch
begründet. (b)<==//
(c)
aus technischen gründen
in den graphiken auf die buchstaben: A und B, verkürzt.
(c)<==//
(2.53.20/(b))<==//
2.25.09
die wiederholung des gedankens:
2.53.20(d), in einer graphik.
Beteiligt sind: das individuum als
ich: A, der genosse: B, und der beobachtende dritte: C,(a).
Die wechselseitigen relationen zwischen den beteiligten: "A<==>B, B<==>C
und C<==>A" werden in der ausgangssituation erfasst. In jeder dieser
wechselseitigen relationen ist das symbol: n, macht repräsentierend, interpolierbar(b).
In der perspektive der analyse ergeben sich also drei schemata, die nicht
identisch fallen können(c),
die aber in der synhetisierenden reflexion von allen, die es betrifft,
miteinander in einer graphik verknüpft, gefasst werden(d).
Die ausgangssituation:
Die relationen:
1.rel.: A<==>B
2.rel.: B<==>C
3.rel.: C<==>A.
graphik: 109a
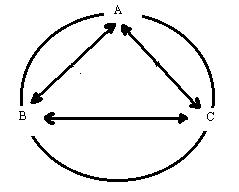
Die schemata: 1-3,:
Die relationen:
1.schema:
1.rel.: A<==>B
2.rel.: A<==|==>symbol:_n
3.rel.: B<==|==>symbol:_n.
graphik: 109b
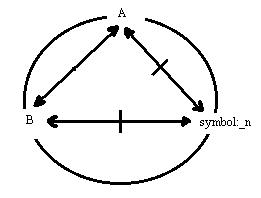
2.schema:
1.rel.: B<==>C
2.rel.: B<==|==>symbol:_n
3.rel.: C<==|==>symbol:_n
graphik: 109c
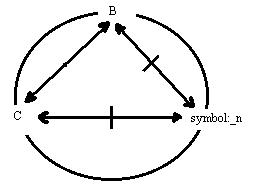
3.schema:
1.rel.: C<==>A
2.rel.: C<==|==>symbol:_n
3.rel.: A<==|==>symbol:_n
graphik: 109d
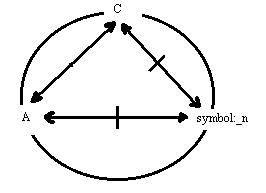
Die verknüpfung der vier schemata
in der
graphik: 109e
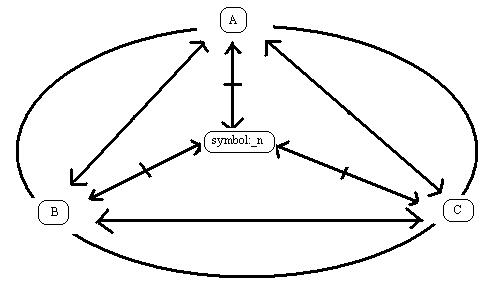
---
(a)
in den graphiken auf die
buchstaben: "A, B und C" verkürzt.
(a)<==//
(b)
//==>argument: 2.25.08.
Zusatz.
Die zeichen: "symbol:_n und (symbol:_n,(=macht))"
bezeichnen dasselbe und sind austauschbar.
(b)<==//
(c)
analog der graphiken: 106b-d,
in argument: 2.25.06.
(c)<==//
(d)
analog der graphik: 106e,
a.a.O. (d)<==//
(2.53.20(d))<==//
2.25.10
die wiederholung des gedankens:
2.53.02/(d), in einer graphik.
Fünf momente sind miteinander
relationiert. Die momente sind: "die ideologien und interessen, als phänomene
die begriffe: herrschaft und macht, und das individuum als ich: A, der
genosse: B, eingeschlossen". In der graphik sind die begriffe: herrschaft
und macht, als phänomene unter einem zeichen zusammengefasst, der
genosse, einschliesslich die wechselseitige relation: A<==>B, auf das
zeichen: individuum als ich, verkürzt.
Das grundschema umfasst die momente:
ideologie, herrschaft/macht und interesse(a).
Die relationen:
1.rel.: ideologie<==|==>herrschaft/macht
2.rel.: ideologie<==|==>interesse
3.rel.: herrschaft/macht<==|==>interesse.
graphik: 110a
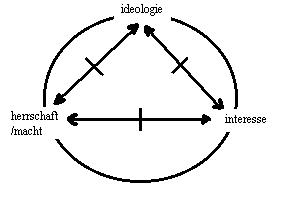
Im grundschema kann das moment: individuum
als ich, an stelle jedes der drei momente: "ideologie, herrschaft/macht
und interesse" eingesetzt werden. Es sind drei schemata, die nicht identisch
fallen können.
1.schema:
Die relationen:
1.rel.: individuum_als_ich<==|==>herrschaft/macht
2.rel.: individuum_als_ich<==|==>interesse
3.rel.: herrschaft/macht<==|==>interesse-
graphik: 110b
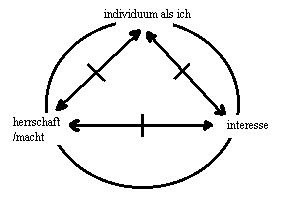
2.schema:
Die relationen:
1.rel.: individuum_als_ich<==|==>interesse
2.rel.: individuum_als_ich<==|==>ideologie
3.rel.: interesse<==|==>ideologie
graphik: 110c
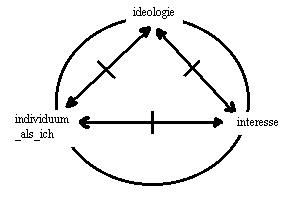
3.schema:
Die relationen:
1.rel.: individuum_als_ich<==|==>ideologie
2.rel.: individuum_als_ich<==|==>herrschaft/macht
3.rel.: ideologie<==|==>herrschaft/macht
graphik: 110d
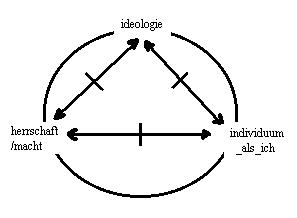
Die schemata: 1-3 in einer graphik
übereinandergelegt:
graphik: 110e
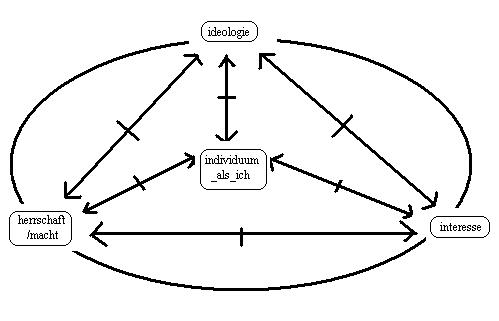
---
(a)
vgl. auch das argument:
2.25.09.
(a)<==//
(2.53.02/(d))<==//
2.25.11
die wiederholung des gedankens:
2.53.02/(h/01), in einer graphik.
In der wiederholung des gedankens
ist die terminologie etwas modifiziert(a),
ohne den kern des arguments anzutasten(b).
Die momente:
1. das individuum_als_ich:
A(=erzähler/=prophet)
2. der genosse: B(=zuhörer/=gläubiger)
3. der schöpfungsmythos.
Im blick auf den schöpfungsmythos
gilt:
graphik: 111a
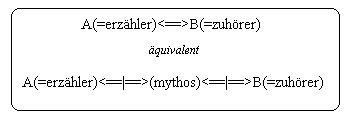
Dasselbe dargestellt im trialektischen
modus:
1.rel.: A(=erzähler)<==>B(=zuhörer)
2.rel.: A(=erzähler)<==|==>(mythos)
3.rel.: B(=zuhörer)<==|==>(mythos)
graphik: 111b
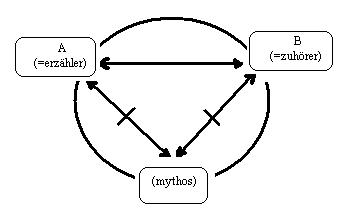
Der gedanke kann in seiner komplexität
weiter entfaltet werden. Vergleiche dazu das argument: 2.25.08/(a), das
analog übertragbar ist.
---
(a)
in den relationsformeln
aus technischen gründen verkürzt.
(a)<==//
(b)
vergleiche auch die argumente:
2.25.07
und 2.25.08, die in ihrer struktur gleich sind
und in denen vergleichbare gegenstände in modifizierten perspektiven
im blick stehen. (b)<==//
(2.53.02/(h/01))<==//
2.25.12
die wiederholung des gedankens:
2.53.31/(b/03), in einer graphik.
Wenn das individuum als ich: A,
den satz: wissen ist macht, ausgedrückt als relation, in der relation:
individuum_als_ich:_A<==|==>(wissen<==|==>macht), fasst, dann fasst
es diese relation immer im horizont eines dritten moments, das ausgeschlossen
ist. Das dritte moment kann entweder die macht sein oder die herrschaft.
Die situation ist komplex.
Zum ersten
kann das individuum als ich die
momente: macht oder wissen, in zwei relationen fassen. Im trialektischen
modus weist die dritte relation: wissen<==|==>macht, das individuum
als ich als das ausgeschlossene dritte moment aus.
Die momente:
das individuum als ich,
das wissen und die macht.
Die relationen:
1.rel.: individuum_als_ich<==|==>wissen
2.rel.: individuum_als_ich<==|==>macht
3.rel.: wissen<==|==>macht.
graphik: 112a
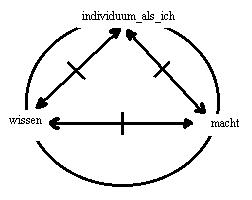
Zum zweiten
kann das individuum als ich die
relation: wissen<==|==>macht, als moment einer relation setzen(a),
aber diese setzung ist nur im horizont eines dritten moments möglich.
Denkbar sind der begriff: welt, die vorstellung einer ideologie, oder,
wie im vorliegenden fall, die relation: macht<==|==>herrschaft.
Die momente sind:
1. das individuum als ich
2. die relation: (wissen<==|==>macht)
3. die relation: (macht<==|==>herrschaft).
Die relationen:
1.rel.: individuum_als_ich<==|==>(wissen<==|==>macht)
2.rel.: individuum_als_ich<==|==>(macht<==|==>herrschaft)
3.rel.: (wissen<==|==>macht)<==|==>(macht<==|==>herrschaft).
graphik: 112b
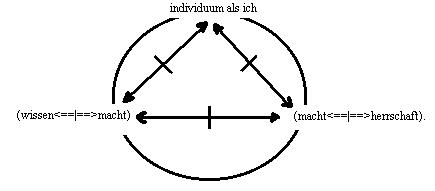
-
Im blick
auf die relation: wissen<==|==>macht, traditional formuliert: wissen
ist macht, sind zwei schemata zu unterscheiden, die nicht identisch fallen.
Zwar kann die relation: wissen<==|==>macht, in der relation: macht<==|==>herrschaft,
als vermittlungsmoment (=wissen ist macht) interpoliert werden,
graphik: 112d (layout)
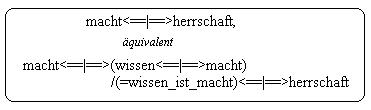
, aber in der darstellung im trialektischen
modus liegen zwei schemata vor, die nicht identisch fallen können
und in einer graphik wie folgt zusammengefasst werden(b).
graphik: 112c
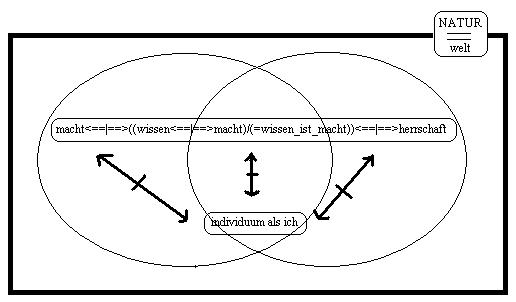
----
(a)
das ist die konstellation,
in der im trialektischen modus scheinbar eine 4.relation gesetzt ist(01).
De facto markiert die sogenannte 4.relation ein neues schema, das mit dem
ausgangsschema nicht identisch fallen kann.
----
(01)
argumente: //==>2.23.10
//==>2.24.14 //==>2.24.33.
Und //==>INDEX/sachregister,
stichwort: relation/4. (a)<==//
(b)
die elipsen im dünnen
strich markieren die schemata. Hinzugefügt ist die unterscheidung:
welt||NATUR. (b)<==//
(2.53.31/(b/03))<==//
2.25.13
der gedanke: 2.53.33/(c),
in einer graphik dargestellt.
Der ausgangspunkt ist die soziale
beziehung zwischen dem individuum als ich: A, und seinem genossen: B. Dazwischen
steht der befehl als das vermittelnde moment.
Die relation: A(=befehlsgeber)<==>B(=befehlsnehmer),
ist äquivalent mit der situation: A(=befehlsgeber)<==|==>(befehl)<==|==>B(=befehlsnehmer),(a).
graphik: 112a
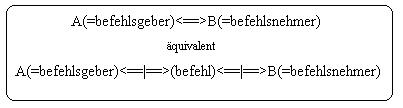
Dargestellt im trialektischen modus,
ist die funktion des befehls als mittel sinnfällig. Die momente sind
das individuum als ich: A, in der funktion des befehlsgebers, der genosse:
B, in der funktion des befehlsnehmers und der befehl.
Die relationen sind:
1.rel.: A(=befehlsgeber)<==>B(=befehlsnehmer)
2.rel.: A(=befehlsgeber)<==|==>befehl
3.rel.: B(=befehlsnehmer)<==|==>befehl.
graphik: 113b
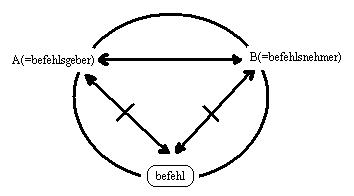
----
(a)
durch den befehl wird die
wechselseitige relation in die beiden abhängigen relationen: A(=befehlsgeber)<==|==>befehl
und befehl<==|==>B(=befehlsnehmer), aufgelöst.
(2.53.33/(c))<==//
2.25.14
die wiederholung des gedankens:
2.53.15/(a), in einer graphik.
Die grundstruktur ist überschaubar(a).
Die momente sind das individuum als ich: A, der genosse: B, und das verbindende
mittel als phänomene der herrschaft und/oder der macht, die gewalt
eingeschlossen.
Die relationen:
1.rel.: ind._als_ich:_A<==>genosse:_B
2.rel.: ind._als_ich:_A<==|==>mittel(=phän.d.macht/herrschaft,gewalt)
2.rel.: genosse:_B<==|==>mittel(=phän.d.macht/herrschaft,gewalt).
graphik: 114
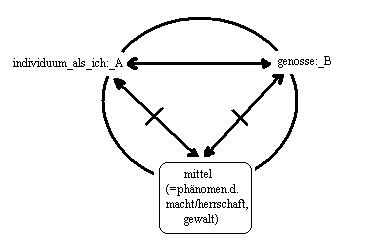 -
-
----
(a)
die struktur der relationen
mit dem moment: mittel, sind dann komplex, wenn das wechselspiel der mittel,
die phänomene der herrschaft und/oder der macht, die gewalt eingeschlossen,
mit in das kalkül einbezogen werden. Die abhängige wechselwirkung
zwischen den phänomenen der herrschaft, der macht und der gewalt ist
andernorts bereits erörtert(01).
----
(01)
argument: //==> 2.25.08.
Zusatz. Weitere hinweise über
das register; die stichworte:
macht, herrschaft und gewalt.
(2.53.15/(a))<==//
2.25.15
die wiederholung des gedankens:
2.53.38/(b/01), in einer graphik.
In der relation: individuum_als_ich:_A<==>genosse:_B,
definiert als eine relation der macht oder der herrschaft, hat das erbstück,
verdinglicht in den symbolen der königswürde, die funktion der
vermittlung. Das erbstück kann ein mittel der macht(=kapital) sein
oder eine chance zur herrschaft(=sozialer status)(a).
Das erbstück ist das vermittelnde
moment, das die wechselseitige relation zwischen dem individuum als ich:
A, und seinem genossen: B, in zwei abhängige relationen verändert,
die, obgleich das erbstück mit sich identisch ist, nicht identisch
fallen können. Das erbstück als das vermittelnde moment hat zwar
die funktion, macht oder herrschaft vertretend zu symbolisieren, aber es
kann die herrschaft oder die macht selbst nicht sein.
graphik: 115a
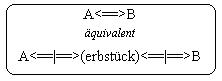
Dasselbe dargestellt im trialektischen
modus.
Die momente:
das individuum als ich:
A,
der genosse: B,
das erbstück(=machtmittel(=kapital)/=chance
zur herrschaft(=sozialer status))(b).
Die relationen:
1.rel.: individuum_als_ich:_A<==>genosse:_B
2.rel.: individuum_als_ich:_A<==|==>erbstück(=m/c)
3.rel.: genosse:_B<==|==>erbstück(=m/c).
graphik: 115b
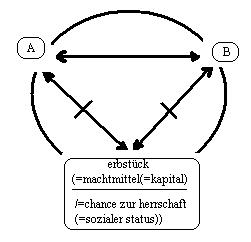
---
(a)
unter dem terminus: erbstück,
können auch die termini: "machtmittel, kapital, chance zur herrschaft
und sozialer status" subsumiert werden. Damit ist, wenn der gedanke im
trialektischen modus dargestellt wird, eine komplexität der möglichkeiten
angezeigt, die, die möglichkeiten in einer graphik zusammenfassend,
nur schwer darstellbar ist(01). Jede relation steht für sich und kann
mit den anderen nicht identisch fallen, gleichwohl diese relationen im
diskurs als gleich, auch fälschlich als identisch gehändelt werden.
----
(01)
die komplexität der
möglichen verknüpfungen wird nicht dargestellt(*1).
----
(*1) argument: //==>2.24.01/(c).
(a)<==//
(b)
aus technischen gründen
gelegentlich auf die zeichen: "A, B und m/c" verkürzt.
(b)<==//
(2.53.38/(b/01))<==//
2.25.16
die wiederholung des gedankens:
2.53.16/(a/04), in einer graphik.
Die relation: individuum_als_ich:_A(=machthabende)<==>genosse:_B(=ohnmächtige),
ist in der vermittlung durch das moment: gnade, äquivalent mit den
möglichen relationen, zusammengefasst in dieser formel: ind.a.i.:_A(=machthabende)<==|==>(gnade)<==|==>gen.:_B(=ohnmächtige).
graphik: 116a
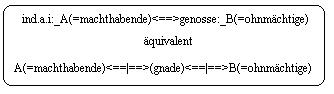
Dasselbe dargestellt im trialektischen
modus.
Die momente:
das individuum als ich(=machthabende)
der genosse(=ohnmächtige)
die gnade(=beliebiges_weltding).
Die relationen:
1.rel.: ind._als_ich(=machthabende)<==>genosse(=ohnmächtige)
2.rel.: ind._als_ich(=machthabende)<==|==>gnade(=beliebiges_weltding)
3.rel.: genosse(=ohnmächtige)<==|==>gnade(=beliebiges_weltding)
graphik:
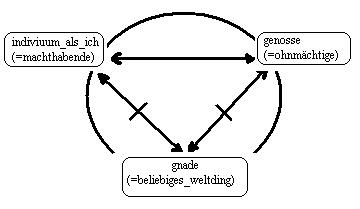
(2.53.16/(a/04))<==//
2.25.17
die wiederholung des gedankens:
2.83.11/(c), in einer graphik.
Der gedanke kann in zwei versionen
als graphik wiederholt werden. Zum ersten sind es die momente: das individuum
als ich, der traum(=forum_internum) und die welt(=forum_publicum), zum
zweiten sind es die momente: das individuum als ich, die geträumte
blüte und die reale frucht. Das, was die welt oder der traum ist,
real vermittelt sind der traum und die welt nur im individuum als ich,
das in der relation: traum<==|==>welt, das ausgeschlossene dritte moment
ist, nicht anders in der relation: blüte<==|==>frucht. Das individuum
als ich hat real verfügbar entweder die welt oder den traum, respektive
die blüte oder die frucht(a).
Die relationen:
1.rel.: individuum_als_ich<==|==>traum(=forum_internum)
2.rel.: individuum_als_ich<==|==>welt(=forum_publicum)
3.rel.: traum(=forum_internum)<==|==>welt(=forum_publicum).
graphik: 117a
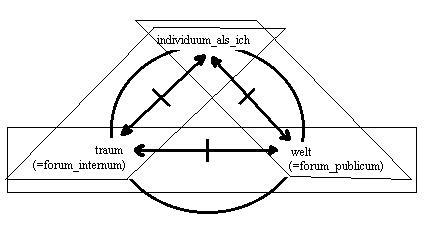
Die relationen:
1.rel.: individuum_als_ich<==|==>blüte
2.rel.: individuum_als_ich<==|==>frucht
3.rel.: blüte<==|==>frucht.
graphik: 117b
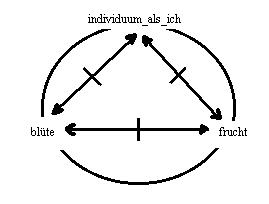
---
(a)
die relationen sind in der
graphik: 117a, exemplarisch mit vierecken in dünnem strich markiert;
in der graphik: 117b, ist die markierung analog zu interpolieren.
(a)<==//
(2.83.11/(c))<==//
2.25.18
die wiederholung des gedankens:
2.83.15/b/04/*3), in einer graphik.
Die momente:
das individuum als ich
der politische prozess(=prozess/politisch)
der politische diskurs(=diskurs/politisch).
Die relationen:
1.rel.: individuum_als_ich<==|==>prozess/politisch
2.rel.: individuum_als_ich<==|==>diskurs/politisch
3.rela.:prozess/politisch<==|==>diskurs/politisch.
graphik: 118
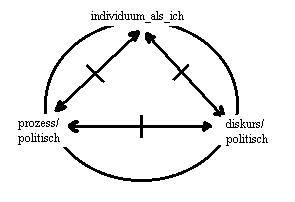
(2.83.15/b/04/*3))<==//
------
fortsetzung:
subtext: 2.31.01
bis 2.31.11
<==//
(anfang/bibliograpische angaben)
stand: 16.04.01.
zurück/übersicht
//
zurück/bibliographie
//
zurück/bibliographie/verzeichnis
//